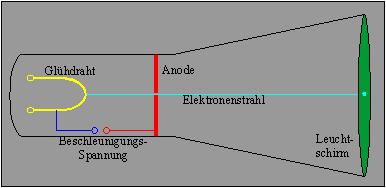
Ausarbeitung
zum Thema "Teilchenbeschleuniger"
Teilchenbeschleuniger sind Anlagen zum
Beschleunigen von geladenen Elementarteilchen oder Ionen auf hohe
Geschwindigkeiten. Teilchenbeschleuniger zählen zu den größten und teuersten
in der Physik verwendeten Vorrichtungen. Sie bestehen im Wesentlichen aus drei
Teilen: einer Quelle zur Freisetzung von Elementarteilchen oder Ionen, einer
weitgehend evakuierten röhrenförmigen Bahn, in der sich die Teilchen frei
bewegen können, und einer Einheit zum Beschleunigen der Teilchen.
Den einfachsten Teilchenbeschleuniger kennt (fast) jeder und die meisten haben
ihn auch zu Hause: eine Braunsche Röhre, die in jedem Fernseher als Bildröhre
vorhanden ist. In einer Braunschen Röhre werden aus einem Glühdraht
austretende Elektronen in einem elektrischen Feld beschleunigt. Diese treffen
auf einen Leuchtschirm und bilden dort einen Leuchtpunkt. Zur Erweiterung zum
Fernseher bedarf es einiger Ablenkeinrichtungen, um den Strahl auf bestimmte
Punkte auf dem Leuchtschirm zu fokussieren.
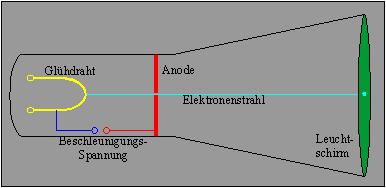
Natürlich erhalten die Elektronen in
einer Fernsehröhre nicht die Energie, die wir benötigen um damit
Teilchenphysik zu betreiben. Es ist jedoch ein gutes Beispiel, um den
Energiegewinn eines geladenen Teilchens in einem elektrischen Feld zu zeigen.
Dabei gilt: Beim Durchlauf einer Spannungsenergie von U = 1000 V gewinnt ein
Elektron die Energie: E= 1 e . 1000 V = 1000 eV = 1 keV
Das erste, zum Beschleunigen von Teilchen gebaute Gerät, war der sogenannte
Linearbeschleuniger (Ende der 20er Jahre). Er dient den Physikern dazu
subatomare Teilchen zu erforschen. Diese wurden mit den nahezu auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigten Teilchen beschossen. Als
"Geschosse" eignen sich aufgrund ihrer kleinen Größe und ihrer
Ladung Elektronen und Ionen. Beim Linearbeschleuniger werden diese Teilchen mit
Hilfe von Wechselspannungen auf einer geraden Bahn vorangetrieben. Für niedrige
Energien nutzt man elektrostatische Felder, bei höheren Energien benutzt man
frequente elektrische Wechselfelder zum Beschleunigen. Die Teilchen passieren
beim Durchgang durch den Beschleuniger eine Reihe röhrenförmig gebauter und
hintereinander stehender Elektroden. Die Frequenz der Wechselspannung wird so
eingestellt, daß ein Teilchen immer dann nach vorne beschleunigt wird, wenn es
die Lücke zwischen zwei Elektroden passiert. Durch dieses andauernde
Beschleunigen wird in die selbe Richtung wird die Energie stufenweise erhöht.
Theoretisch kann man mit einem Linearbeschleuniger Teilchen auf ein beliebiges
Energieniveau bringen. Mit einer Länge von 3,2 Kilometern zählt der
Linearbeschleuniger an der Stanford University (Kalifornien) zu den größten
der Welt. Hier können Elektronen auf Energien von bis zu 50 Gigaelektronenvolt
(50 Milliarden Elektronenvolt) gebracht werden.
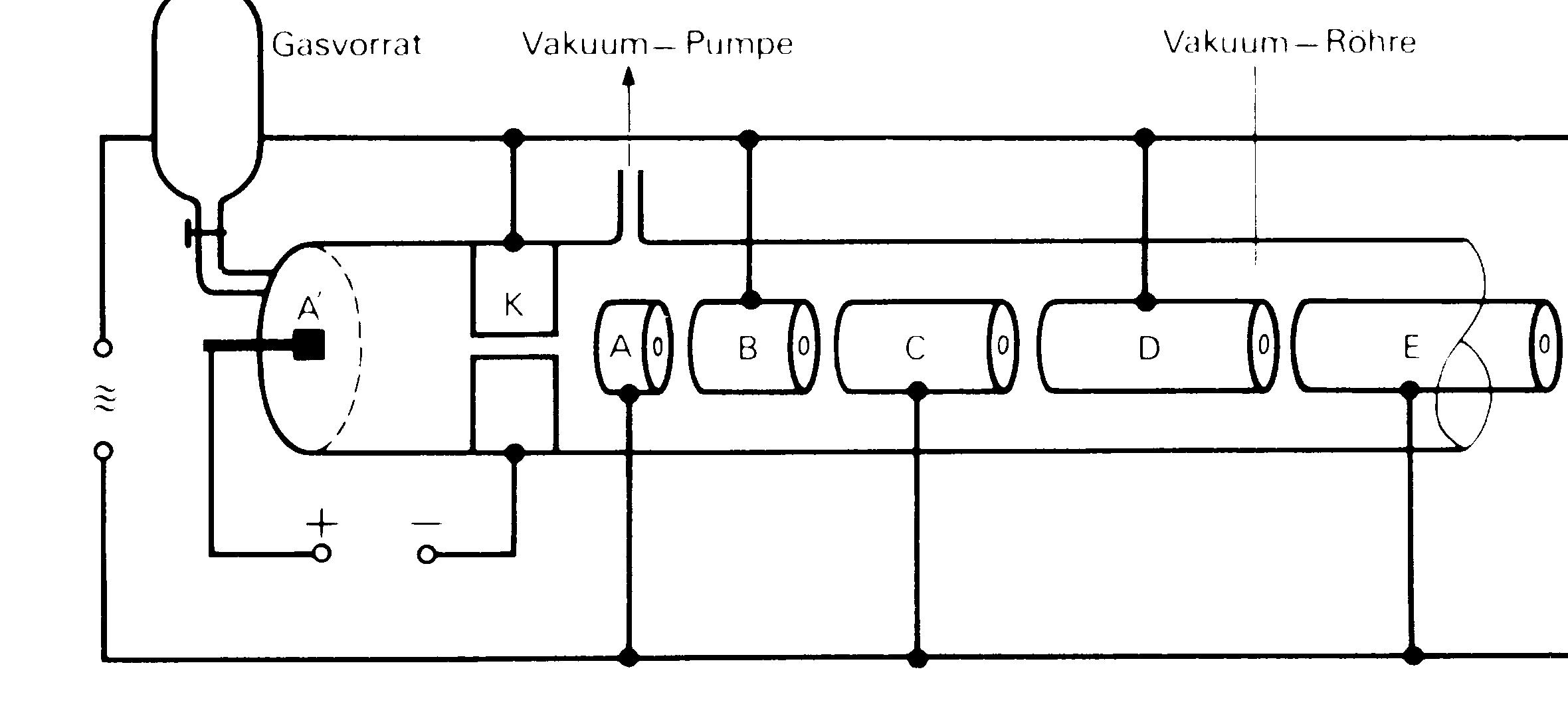
Neben dem Linearbeschleuniger gibt es noch
die Zirkularbeschleuniger. Bei diesen Kreisbeschleunigern werden die
beschleunigten Teilchen auf kreisartige Bahnen geführt und können auf diese
Weise ein oder mehrere elektrische Felder fast beliebig oft durchlaufen. Bei den
Kreisbeschleunigern unterscheidet man drei verschiedene Arten. Da wäre zum
einen das von amerikanischen Physiker Ernest O. Lawrence entwickelte Zyklotron.
Lawrence erhielt 1939 für diese Entwicklung auch den Physik-Nobelpreis. Das
Zyklotron ähnelt vom Arbeitsprinzip her einem Linearbeschleuniger. Die Bahn,
auf der sich die Teilchen bewegen sind jedoch entweder kreisförmig oder zu
einer Spirale geformt.
Mit Hilfe eines Elektromagneten erzeugt man ein Magnetfeld, welches senkrecht zu
den Flugbahnen der Teilchen verläuft. Dadurch werden die Teilchen auf der gekrümmten
Bahn gehalten. Zwischen den Polschuhen des Magneten liegt die Vakuumkammer, in
der die Beschleunigung stattfindet. Dort befinden sich zwei halbkreisförmige
Elektroden, die sogenannten Duanten. Sie sehen im Querschnitt wie der Buchstabe
D aus und werden deshalb auch D's (oder Dees) genannt. Sie sind mit der geraden
Linie aneinandergesetzt: d D. Bei jedem durchfließen der Lücken
zwischen den Dees werden sie beschleunigt. Während die Teilchen mehr und mehr
Energie aufnehmen wird zwangsläufig auch der Durchmesser der spiralförmigen
Bahn immer weiter. Schließlich gelangen sie an den Rand des Beschleunigers und
verlassen ihn.
Die Beschleunigung der Teilchen wird durch die Lichtgeschwindigkeit begrenzt. Je
näher die Geschwindigkeit der Teilchen an die der Lichtgeschwindigkeit heran
kommt, desto drastischer nimmt ihre Masse zu. Nach Einsteins Relativitätstheorie
wäre die Masse eines Teilchens bei Lichtgeschwindigkeit unendlich groß. In den
ersten Zyklotronen kamen die Beschleunigungsstöße in der Lücke der Dees zum
jeweils zum falschen Zeitpunkt. Im Zusammenhang mit diesem Problem entwickelten
der russische Physiker Wladimir Weksler und der amerikanische Physiker Edwin MC
Millan das sogenannte Synchrozyklotron.
Dieses Synchrozyklotron arbeitet nach einem frequenzmodulierten Prinzip.
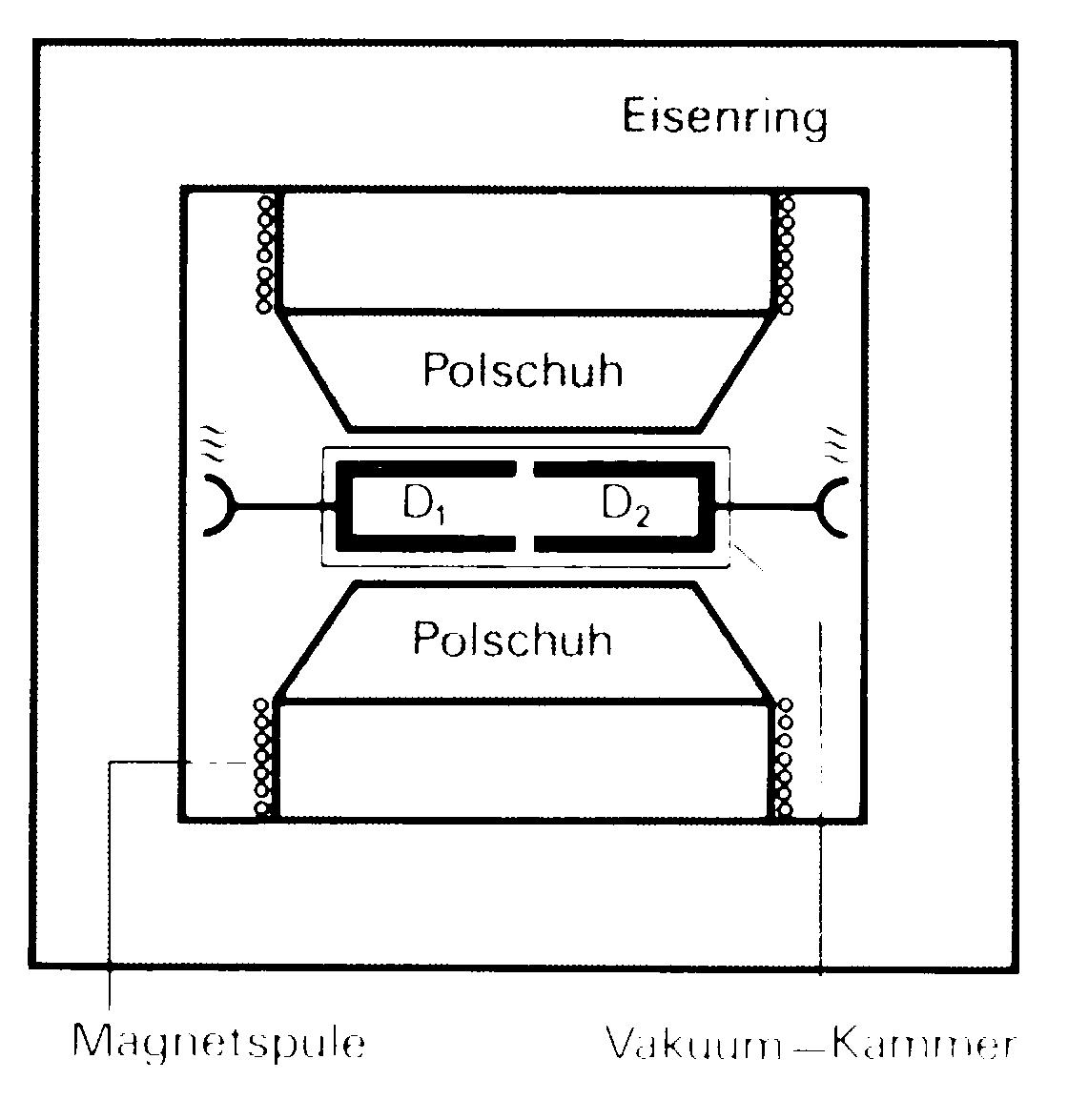
Durch das automatische Steuern der
Generatoren für die Radiofrequenz zum Beschleunigen der Teilchen kamen die
Beschleunigungsstöße jeweils im richtigen Takt. Den Frequenztakt verlangsamt
man in dem Maß, in dem die Masse der Teilchen zunimmt. Für höhere maximalen
Energien muss logischerweise das Synchrozyklotron auch größer werden, denn die
Radien der Teilchen nehmen ja mit höherer Energie zu.
Im derzeit leistungsstärksten Zyklotron in der Universität von Michigan (USA)
erreichen die Atomkerne etwa 8 Gigaelektronenvolt.
Anhand der folgenden Abbildung kann man den Wechsel von Beschleunigung und
Lenkung der Ionen im Zyklotron erkennen:
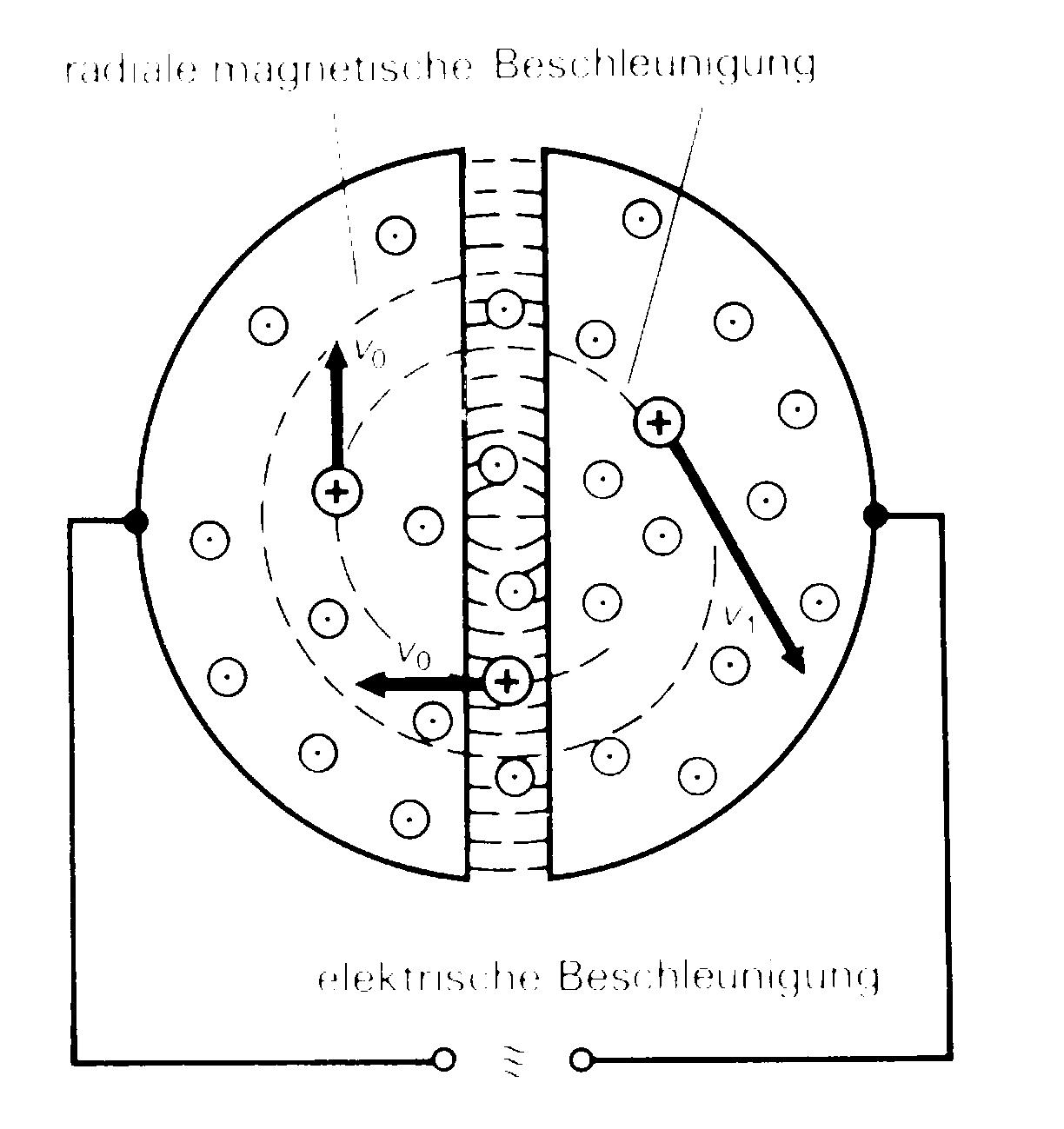
Neben dem eben beschriebenen Zyklotron
gibt es bei den Teilchenbeschleunigern noch das sogenannte Betatron. Das
Betatron wurde dazu entwickelt, um auch Elektronen stark beschleunigen zu können.
Da die Masse der Elektronen beim Beschleunigen schon bei relativ geringen
Energien drastisch ansteigt musste etwas anderes gefunden werden als das
Zyklotron. Bei einer Energie von einem MeV hat eine Elektron bereits eine
dreimal so große Masse wie ein ruhendes Elektron. Das Betatron besteht aus
einer Vakuumkammer, die aus zwei Hälften einer abgeflachten Kugel
zusammengesetzt ist und sich zwischen den Polen eines Magneten befindet. Die
Elektronen werden auch hier durch ein Magnetfeld (Führungsfeld) auf ihrer
Kreisbahn gehalten. Dieser Elektromagnet wird mit Wechselstrom betrieben. Die
Elektronen werden durch die Kräfte, die von den Änderungen des magnetischen
Flusses entlang der Kreisbahn herrühren, beschleunigt. Führungsfeld und
magnetischer Fluss werden dabei so variiert, dass der Radius der
Elektronenbahnen immer gleich bleibt.
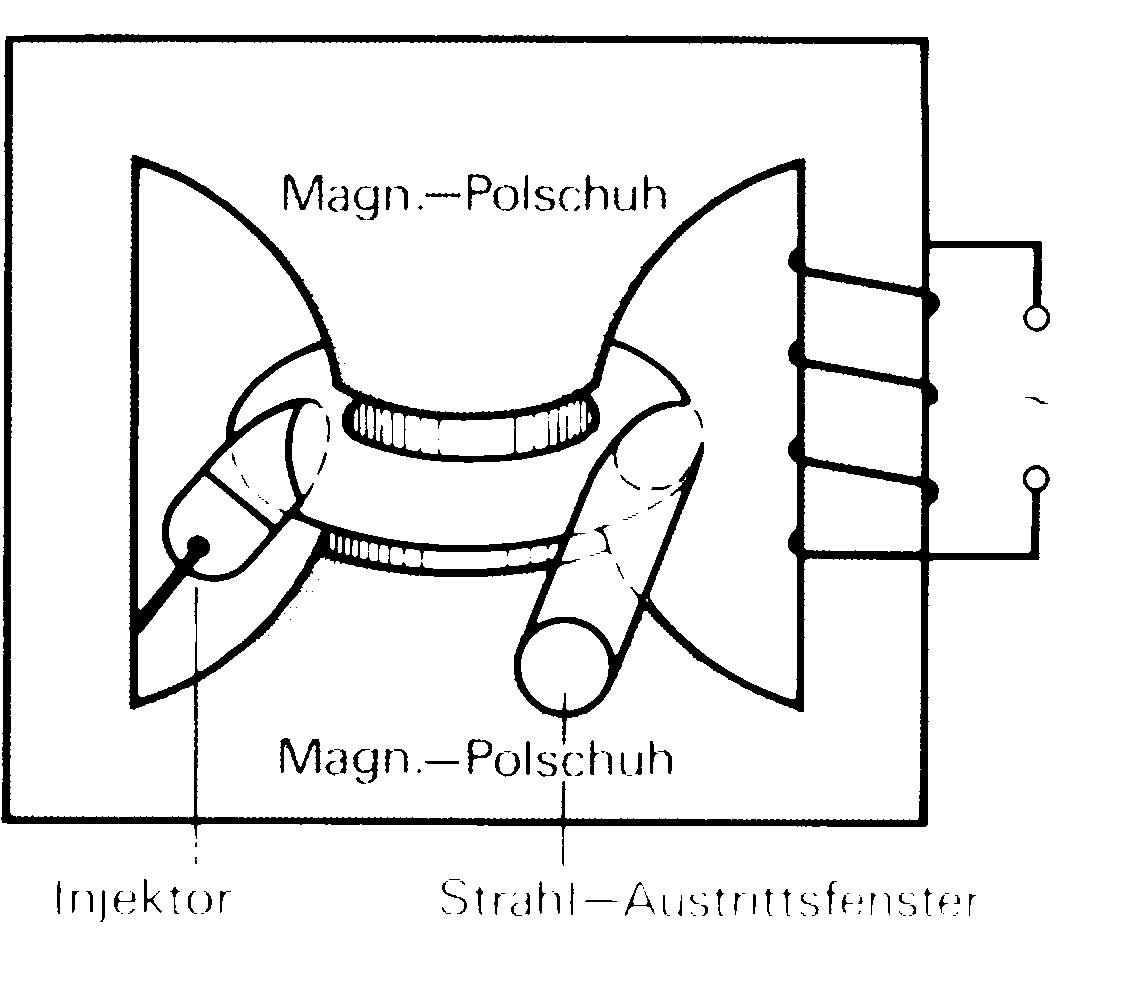
Kaum anders arbeitet das Synchrotron,
hierbei werden die Teilchen jedoch vor dem Eintritt in den Kreisring schon auf
Energien von einigen Millionen Elektronenvolt gebracht. Innerhalb des
Kreisringes werden sie dann an einem oder an mehreren Punkten bei jedem Umlauf
weiter beschleunigt. Um sie bei dieser Beschleunigung auf der Kreisbahn zu
halten muß das Magnetfeld entsprechend ihrer Energiezunahme verstärkt werden.
Schon nach wenigen Sekunden treten die mit Energien von über einem
Gigaelektronenvolt geladenen Teilchen aus. Man kann sie entweder direkt bei
Experimenten verwenden oder man beschießt mit ihnen Substanzen, aus denen sie
bestimmte Elementarteilchen herausschlagen können. Beschleuniger, die nach dem
Prinzip des Synchrotrons arbeiten kann man sowohl für Protonen als auch für
Elektronen verwenden. Die größten Anlagen dieses Typs sind allerdings
Protonenbeschleuniger.
Teilchenbeschleuniger finden jedoch nicht nur in der Physik Anwendung, sondern
auch in der Medizin. 1997/98 kooperierten physikalische und medizinische
Forschungslabore bei der Nutzung der von Teilchenbeschleunigern erzeugten
Synchronstrahlung insbesondere bei der Behandlung von Krebskranken. Die
Bestrahlung mit Hilfe schwerer Ionen hat den Vorteil, daß dabei kein gesundes
Gewebe zerstört wird. Da schwere Ionen sehr tief in Gewebe eindringen können
und ihr Strahl sich mit zunehmender Tiefe intensiviert wird nur der Tumor nicht
aber gesundes Gewebe zerstört. Einziger Nachteil dieser Art der Behandlung sind
die immens hohen Kosten, die etwa um die 30.000,- DM liegen.
Mit Hilfe der Neutronen-Strahlen können sogenannte Oberflächentumore behandelt
werden.
Die Protonen-Bestrahlung wird zur Behandlung von Augentumoren eingesetzt; ist
jedoch für jeden schnell wachsenden Tumor einsetzbar. Die Kosten für eine
Behandlung liegen bei etwa 20.000,- DM.
Und das alles nur um
herauszufinden, was die Welt im innersten zusammenhält...
Ich habe keine Note auf diese
Ausarbeitung bekommen (Physik GK | Jahrgangsstufe 12/II)
© by Robert
Vater, 1999
Layout by Robert
Vater, 2000
Korrigiert von: [Herr Schotte]